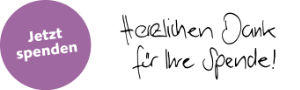In einer Diskussionsrunde nach einem Vortrag von mir kam die Frage aus dem Publikum auf, ob Hörgeräte nicht schädliche Strahlen in den Kopf schicken. Es bestand die Angst, die elektromagnetischen Bauteile würden Strahlen in das Gehirn des Hörgeräteträgers senden. Bluetooth und Nahstreckenfunk würden das noch schlimmer machen.
Grund genug für uns, Ihnen das einmal zu erklären:
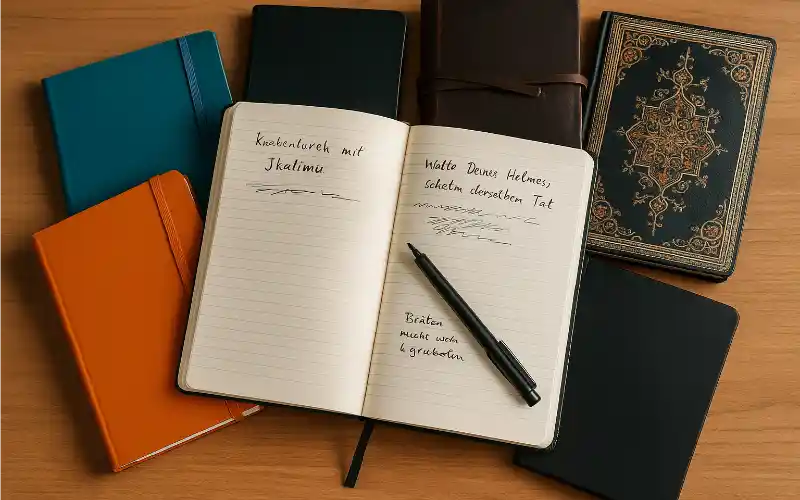
Aber zuerst sei uns dieser Hinweis gestattet:
Wenn Sie glauben, elektroempfindlich zu sein, wenn Sie Ihre Wohnung mit Strahlenschutzfarbe gestrichen haben und Unterwäsche aus Metallgeflecht tragen, dann haben Sie eine eigene Meinung zu diesem Thema, die von den publizierten wissenschaftlichen Erkenntnissen abweicht.
Wir wollen Ihre Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten und Ihren Leidensdruck nicht herabwürdigen, nur werden Sie aus diesem Artikel keinen Nutzen ziehen können.
Wer allerdings die ganze Angelegenheit aufgrund von Fakten einmal näher betrachten will, der ist bei diesem Artikel hier richtig.
Welche Frequenzen verwenden Hörgeräte?
Wir haben es bei Hörgeräten im Wesentlichen mit 4 verschiedenen Bereichen zu tun, die sich in Funk und Induktion aufteilen. Die Übertragungen finden auf verschiedenen Frequenzen und mit unterschiedlichen Sendeleistungen statt.
Induktive Höranlagen (Induktionsschleifen)
Bei induktiven Höranlagen werden Signale im normalen Audio-Niederfrequenzbereich übertragen. Nach Norm DIN EN 60118-4 liegt dieser zwischen etwa 100 und 5000 Hz, praktisch meist bei 80–6500 Hz. Die maximal zulässige Feldstärke beträgt 400 mA/m.
In Kirchen, Theatern und Museen sind solche Induktionsschleifenanlagen weitverbreitet. Sie ermöglichen es Hörgeräteträgern, störungsfrei Audiosignale drahtlos über ihre Hörgeräte zu empfangen. Voraussetzung ist, dass das Hörgerät über eine sogenannte Telefonspule (kurz T-Spule) verfügt, die dieses magnetische Wechselfeld aufnimmt.
Dabei handelt es sich nicht um Funk im physikalischen Sinn, sondern um eine elektromagnetische Kopplung – vergleichbar mit einem Transformator. Das bedeutet: Der Empfänger entnimmt dem Sender direkt Leistung. Der Sender „merkt“ also, dass Empfänger vorhanden sind.
Zusätzlich gibt es auch die sogenannte NFMI-Technik (Near Field Magnetic Induction), die im Hochfrequenzbereich um etwa 3 MHz arbeitet. Sie wird von einigen Hörgeräten – etwa älteren Modellen von Widex – oder für die Kommunikation zwischen rechtem und linkem Hörgerät genutzt. Hierbei empfängt ein Zwischengerät (z. B. ein Umhängerät) Signale wie Bluetooth oder FM und überträgt diese per NFMI ins Hörgerät.
Induktionsherde, Scanner am Flughafen, Fernsehgeräte, ja sogar Geschirrspüler und Energiesparlampen emittieren ebenfalls elektromagnetische Felder. Messungen haben ergeben, dass drahtlose Hörgeräte auf so geringe Feldstärken kommen, die sogar weit unterhalb der Emissionen eines Geschirrspülers liegen.
Induktive Systeme werden auch heute noch in Neubauten installiert und vielfach nachträglich in bestehende Gebäude eingebaut. Sie gelten nach wie vor als bewährte Technik, um Hörgeräteträgern einen barrierefreien Zugang zu Informationen und Veranstaltungen zu ermöglichen.
Aus Sicht vieler Experten handelt es sich jedoch um ein auslaufendes System. Der Grund liegt vor allem in den hohen Installations- und Betriebskosten, die im Vergleich zu modernen Funklösungen erheblich sind. Bluetooth-Anwendungen und insbesondere das neue Auracast bieten wesentlich günstigere und flexiblere Alternativen und werden die klassische Induktionsschleife voraussichtlich in den kommenden Jahren vollständig ablösen.
Elektromagnetische Übertragung
Früher nutzten einige Hersteller Funkübertragungen bei 10,6 MHz mit einer Bandbreite von rund 300 kHz, bevor sich die heutige 2,4-GHz-Technik durchgesetzt hat. Auch hier wurden nur minimale Feldstärken gemessen. Diese lagen beispielsweise bei 3 mV/m auf 1 m, was 0,18 Picowatt entspricht.
Wiederum kann gesagt werden, dass Halogenlampen und der normalerweise gar nicht verdächtige Geschirrspülautomat mehr emittieren.
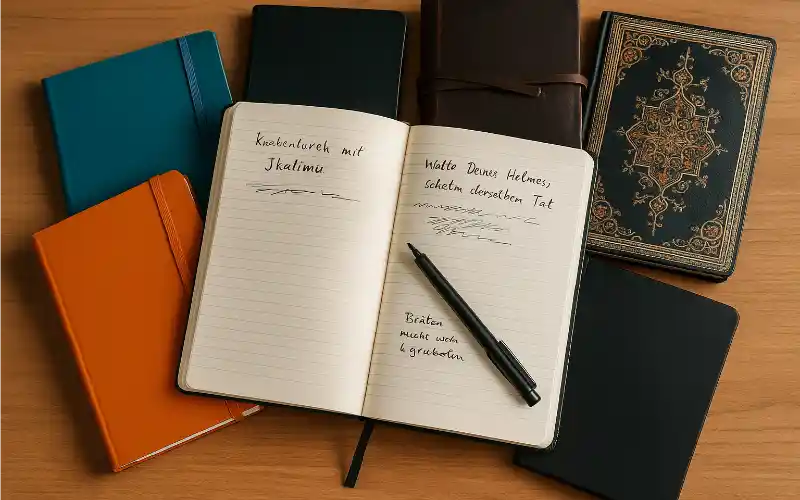
Noch deutlicher wird das im Vergleich zu anderen Geräten:
Ein W-LAN-Router (Sender) darf im Maximum 100 mW bis 1000 mW Sendeleistung nutzen. Das ist also maximal 1 Watt. Im Vergleich dazu dürfte ein Hörgerät 2 mW haben, wobei dieser Wert derzeit noch gar nicht ausgeschöpft wird. Die Geräte haben in Hinblick auf eine lange Lebensdauer der Batterie eine Stromaufnahme von nur 1–2 mA.
Eine richtige Strahlenschleuder ist im Vergleich dazu auch das schnurlose Telefon. Dieses kann 250 mW erreichen, also mehr als das Hundertfache. Und ein schnurloses DECT-Telefon halten Sie sich ebenfalls, mitunter stundenlang, direkt an den Kopf.
Bluetooth low energy
Bluetooth ist in aller Munde und kaum noch ein Gerät der modernen Kommunikations- und Unterhaltungselektronik kommt ohne Bluetooth aus.
Hierbei handelt es sich um eine standardisierte Kurzstreckenfunkanwendung im Frequenzbereich von 2,4 – 2,485 GHz.
Bluetooth nutzt Funkfrequenzen des weltweit unlizenzierten ISM-Bands (ISM = Industrial Scientific Medical) zwischen 2,4000 und 2,4835 Gigahertz (GHz).
Es gibt drei Sendeleistungsklassen, die abhängig von weiteren Parametern unterschiedliche Reichweiten ermöglichen:
Klasse 3: bis 1,0 Milliwatt (mW) für Anwendungen im unmittelbaren Nahbereich bis höchstens ungefähr 10 Meter.
Klasse 2: bis 2,5 mW für Reichweiten im Bereich des Büroarbeitsplatzes bis zu einigen 10 Meter.
Klasse 1: bis 100,0 mW für Reichweiten von 100 Meter und mehr. Laut Standard müssen Geräte dieser Klasse die aktuelle Sendeleistung entsprechend dem tatsächlichen Bedarf automatisch anpassen.
Das Bundesamt für Strahlenschutz sagt dazu:
Bei Einhaltung der empfohlenen Höchstwerte sind nach derzeitiger Kenntnis keine gesundheitlich nachteiligen Wirkungen auf Körpergewebe nachgewiesen.
Auracast – die neue Generation des Hörens
Eine ganz neue Technik, die derzeit in modernen Hörgeräten Einzug hält, ist Auracast.
Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des Bluetooth-Standards, genauer gesagt um eine Funktion von Bluetooth Low Energy (LE Audio).
Auracast ermöglicht es, Audiosignale nicht nur an ein einzelnes Gerät zu übertragen, sondern gleichzeitig an viele Empfänger.
Für Hörgeräteträger bedeutet das:
Man kann sich künftig in öffentlichen Räumen wie Flughäfen, Bahnhöfen, Theatern oder Konferenzsälen direkt mit dem Audio-Signal verbinden.
Statt einer klassischen Induktionsschleife wird dann ein Auracast-Sender installiert, dessen Signal von jedem kompatiblen Hörgerät oder Smartphone empfangen werden kann.
Damit lassen sich z. B. Ansagen am Gate, Vorträge oder Musikdarbietungen klar und störungsfrei hören.
Ein weiterer Vorteil: Auracast funktioniert weltweit standardisiert und ohne Zusatzgeräte.
Der Hörgeräteträger braucht nur ein modernes Gerät, das LE Audio unterstützt.
So könnte Auracast die bisherige Technik der Induktionsschleifen langfristig ablösen.
Auch hier gilt, dass die Sendeleistungen äußerst gering sind.
Die Technik baut auf den gleichen Bluetooth-Frequenzen im 2,4 GHz-Bereich auf und gilt daher nach aktuellem Kenntnisstand als unbedenklich für die Gesundheit.
Was bedeutet das für Hörgeräteträger?
Als Hörgeräteträger kann man heutzutage fast kein Hörgerät mehr bekommen, das nicht in irgendeiner Weise eine dieser Funktechniken nutzt.
Die Hörgerätehersteller rüsten inzwischen immer mehr Hörgeräte mit Funk aus.
Nur noch einfache Geräte aus dem Bereich der Kassenhörgeräte und Einstiegsgeräte verfügen über keinerlei Funktechnik.
Je teurer und luxuriöser die Hörgeräte sind, umso mehr drahtlose Funkanwendungen sind eingebaut.
Dabei wird folgendes genutzt:
Die einfacheren Hörgeräte mit Zuzahlung ermöglichen teilweise die gemeinsame Steuerung beider Hörgeräte. Hierzu muss nur ein Hörgerät geregelt werden und das andere regelt sich automatisch mit. Das geschieht ebenfalls heutzutage mit Funk.
Auch das gemeinsame Steuern von Hörprogrammen, wie die Beeinflussung der Richtwirkung und die Auswahl des Programms werden so ermöglicht. Hinzu kommt das Übertragen von Telefonaten vom einen auf das andere Ohr, damit der Hörgeräteträger beidohrig telefonieren kann.
Außerdem sind noch die vielfach verfügbaren Streaming-Funktionen von Audio- oder Smartphone-Signalen vom und zum Hörgerät zu nennen.
Wollte man dem entgehen, müsste man auf einfachere Geräte ausweichen oder aber teuer mitbezahlte Funktionen durch den Hörakustiker abschalten lassen.
Fazit:
Im rechten Licht betrachtet ist die Strahlenbelastung durch Hörgeräte äußerst gering.
Wir alle sind tagtäglich durch WLAN, gepulste DECT-Telefone und zahlreiche andere Geräte mannigfaltigen Formen der elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt. PowerLan, Babyphones, Funkfernsteuerungen und vieles mehr umgeben uns.
So können wir angesichts der extrem niedrigen Leistung der Hörgeräte in Bezug auf Funkstrahlung ohne weiteres sagen, dass man das vernachlässigen kann.
Bei Hörgeräten überwiegt in der Regel der Nutzen, wollte man eine Risikoabwägung vornehmen. Denn es gäbe zahlreiche Möglichkeiten, auf unnütze und wesentlich stärkere Strahlenverursacher zu verzichten.
Dennoch gilt: Wenn Sie keine Streaming-Funktionen benötigen, sollten Sie auch keine entsprechenden Hörgeräte kaufen. Sie sparen Geld und bekommen trotzdem gute Hörgeräte.
Überarbeitet am 23.08.2025 unter dankbarer Verwendung von Hinweisen unseres Lesers Norbert L. M., M.A.
Der Originalartikel enthielt einige peinliche Fehler. Danke für die Verbesserungshinweise.
Bildquellen:
Hashtags:
Ich habe zur besseren Orientierung noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels zusammengestellt:
#bluetooth #elektrosmog #frequenz #funk #hörgerät #schädigung #schädlich #strahlen #strahlenbelastung #wellen