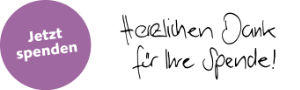In Deutschland ermöglicht das Krankenkassensystem nahezu jedem Zugang zu einem Hörgerät, ohne größere finanzielle Belastungen1. Dennoch entscheidet sich weniger als die Hälfte der Menschen mit Hörverlust für eine Versorgung mit einem Hörgerät. Neben der Angst vor Stigmatisierung, die eine große Rolle spielt, gibt es einen weiteren, oft übersehenen Grund: Viele unterschätzen das Ausmaß ihres Hörproblems oder ignorieren es komplett.
Wie können Hörakustiker diesem Verhalten entgegenwirken und die Akzeptanz von Hörgeräten erhöhen?
Wahrnehmung versus Realität
Die Art und Weise, wie Menschen ihre Hörfähigkeit wahrnehmen, beeinflusst ihre Entscheidungen erheblich. Für viele ist ihre subjektive Wahrnehmung die „Realität“ – selbst wenn objektive Tests eindeutig einen Hörverlust nachweisen. Diese Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und tatsächlichem Zustand erschwert die Beratung und Versorgung durch Hörakustiker.
Die Selbstüberschätzer
Menschen, die ihren Hörverlust herunterspielen, glauben oft, sie könnten problemlos am Alltag teilnehmen. Ein häufiges Beispiel: Ein älterer Mensch in einer geselligen Runde überhört Teile eines Gesprächs, glaubt aber, dass das am „Hintergrundlärm“ liegt und nicht an einem eigenen Defizit. Studien zeigen, dass diese Gruppe ihre Hörfähigkeit oft stark überschätzt. Sie nehmen weniger Probleme wahr und sehen deshalb keine Notwendigkeit, ein Hörgerät zu nutzen.
Die Selbstunterschätzer
Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ihre Hörfähigkeit unterschätzen. Diese Gruppe empfindet ihr Hören oft schlechter, als es objektive Tests nahelegen. Ihre Erwartungen an ein Hörgerät sind oft überzogen, was dazu führt, dass sie mit den erzielten Verbesserungen unzufrieden sind. Ein Beispiel: Jemand, der trotz gutem Hörvermögen in lauter Umgebung Schwierigkeiten hat, könnte glauben, ein Hörgerät würde seine Fähigkeit, Stimmen zu isolieren, perfekt optimieren – eine unrealistische Erwartung.
Wie können Hörakustiker unterstützen?
Hörakustiker spielen eine Schlüsselrolle dabei, die Diskrepanz zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiver Realität zu überbrücken. Mit einer Kombination aus Aufklärung, Tests und gezielter Beratung können sie dazu beitragen, Vorbehalte abzubauen und die Akzeptanz von Hörgeräten zu fördern.
1. Bewusstsein schaffen
Ein erster Schritt ist die Sensibilisierung für die Folgen eines unbehandelten Hörverlusts. Viele Menschen wissen nicht, dass Hörprobleme weit über das bloße „Nichtverstehen“ hinausgehen und schwerwiegende Folgen haben können, wie:
- Kognitive Beeinträchtigungen: Studien zeigen, dass unbehandelter Hörverlust mit einem erhöhten Risiko für Demenz verbunden ist.
- Soziale Isolation: Menschen mit Hörproblemen ziehen sich oft aus sozialen Interaktionen zurück, was ihr Wohlbefinden stark beeinträchtigen kann.
- Berufliche Einschränkungen: Im Arbeitsleben kann ein Hörverlust Missverständnisse und Kommunikationsprobleme verursachen.
Hörakustiker können diese Aspekte in Beratungsgesprächen ansprechen und mit Alltagsbeispielen verdeutlichen: „Haben Sie bemerkt, dass Sie öfter nachfragen müssen, wenn Ihr Enkel spricht?“ oder „Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie sich bei Familienfeiern weniger beteiligen?“.
2. Kombination von Tests
Neben klassischen objektiven Verfahren wie dem Oldenburger Satztest sollten Hörakustiker auch subjektive Einschätzungen der Hörfähigkeit einholen. Indem sie Kunden bitten, ihre eigene Hörfähigkeit auf einer Skala von 0 bis 100 zu bewerten, können sie ein besseres Verständnis für die Wahrnehmung des Betroffenen entwickeln. Der Vergleich von subjektiven und objektiven Testergebnissen kann oft erhellend sein:
- Selbstüberschätzer erkennen, dass sie mehr Probleme haben, als ihnen bewusst ist.
- Selbstunterschätzer gewinnen Vertrauen, wenn sie sehen, dass ihr Hören objektiv besser ist, als sie dachten.
3. Personalisierte Beratung
Hörakustiker können ihre Beratung individuell anpassen:
- Für Selbstüberschätzer: Klare Beispiele aus dem Alltag zeigen, was sie durch den Hörverlust verpassen. Hier kann es hilfreich sein, Hörgeräte vorzuführen, um den Unterschied zu demonstrieren.
- Für Selbstunterschätzer: Eine einfühlsame Beratung, die unrealistische Erwartungen korrigiert, hilft, Enttäuschungen zu vermeiden. Das schrittweise Testen verschiedener Technologielevel und regelmäßige Nachbetreuung können das Vertrauen in die Hörgeräte stärken.
4. Erfolgsnachweise sichtbar machen
Viele Menschen zweifeln an der Effektivität von Hörgeräten, selbst wenn diese objektiv eine deutliche Verbesserung bewirken. Hörakustiker können durch regelmäßige Nachtests und Daten zur Hörverbesserung den Nutzen greifbar machen. Eine Aussage wie „Ihre Sprachverständlichkeit hat sich um 30 % verbessert“ kann ein starker Motivator sein.
5. Moderne Hörgeräte positiv präsentieren
Ein häufiges Hindernis ist die Angst vor Stigmatisierung. Hörakustiker können dazu beitragen, das Image von Hörgeräten zu modernisieren:
- Diskrete Designs: Zeigen, wie unauffällig moderne Hörgeräte sein können.
- Technologische Innovationen: Hörgeräte bieten heute Funktionen wie Bluetooth-Konnektivität, die das Leben erleichtern. Ein Hinweis darauf, dass Hörgeräte nicht nur ein „Hilfsmittel“, sondern auch ein praktisches Gadget sind, kann die Akzeptanz erhöhen.
Fazit
Hörakustiker sind mehr als nur technische Experten – sie sind auch Psychologen, Pädagogen und Kommunikatoren. Ihre Aufgabe besteht darin, Menschen dabei zu helfen, die Realität ihres Hörverlusts zu erkennen, Vorurteile zu überwinden und die Vorteile moderner Hörgeräte zu verstehen. Mit der richtigen Ansprache und einem individuell angepassten Ansatz können sie dazu beitragen, dass mehr Menschen den Schritt zur Versorgung mit einem Hörgerät wagen – für ein besseres Hören und eine höhere Lebensqualität.
Quellen
Es gibt mehrere Studien und Aufsätze, die sich mit der Ablehnung von Hörgeräten und der Rolle von Hörakustikern befassen. Hier sind einige relevante Quellen:
- EuroTrak Hörstudie 2022:
Diese Studie des Bundesverbands der Hörsysteme-Industrie e.V. (BVHI) untersucht die Nutzung von Hörgeräten in Deutschland und beleuchtet Gründe für die Ablehnung sowie die Vorteile einer Hörgeräteversorgung.
Zur Studie - „Hörgeräte und ihr Stigma – wie werden wir es endlich los?“:
Ein Artikel, der sich mit dem Stigma rund um Hörgeräte auseinandersetzt und die Rolle des Hörakustikers bei der Entscheidungsfindung betont.
Zum Artikel - „Studie bestätigt: Mit Hörgeräten geht es Schwerhörigen in allen Lebenslagen besser“:
Dieser Beitrag fasst Forschungsergebnisse zusammen, die die positiven Auswirkungen von Hörgeräten auf verschiedene Lebensbereiche hervorheben.
Zum Beitrag - „Hörgeräte unterschätzt: Studie zeigt Versorgungslücke“:
Ein Artikel, der auf eine Studie verweist, die eine erhebliche Unterversorgung mit Hörgeräten in Deutschland aufdeckt und mögliche Gründe dafür diskutiert.
Zum Artikel - „Gebrauchsnutzen moderner Hörsysteme“:
Ein wissenschaftlicher Artikel, der den Nutzen moderner Hörgeräte im Alltag untersucht und Faktoren identifiziert, die die Akzeptanz beeinflussen.
Zum Artikel - „Hörgerätenutzung im Alter: Welche Rolle spielt die Alltagsgestaltung?“:
Diese Studie der Universität Erlangen-Nürnberg untersucht die Tragedauer von Hörgeräten bei älteren Menschen und die Einflussfaktoren auf deren Nutzung.
Zur Studie
Fußnoten:
- die einzige direkte Ausgabe für Betroffene ist die Rezeptgebühr von 10 € pro Ohr (zurück)
Hashtags:
Ich habe zur besseren Orientierung noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels zusammengestellt:
#EuroTrak-Studie #hörakustiker #Hörgeräte #Hörgeräteakzeptanz #hörgeräteberatung #Hörgeräteversorgung #Hörprobleme #Hörstigma #hörverlust #kognitive Beeinträchtigungen